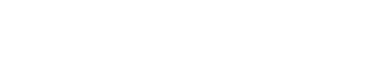- Objekt:
Tafelbild in Holzrahmen; beidseitig bemalt
- Beschreibung:
Vorderseite: alpine Landschaft mit Birken und Haus am See; Maler oder Malerin unbekannt. Rückseite: Kniestück von Adolf Hitler in Rigaud-Pose mit Uniform und Mantel; Maler oder Malerin unbekannt, andere Hand als Vorderseite.
- Produzent:
Keine Angaben; Schenkung aus Bevergern/ Westfalen, 2021
- Material:
Holzrahmen, Ölfarbe auf Holz
- Maße:
Rahmen Außenseite 104,5 x 79,5 cm, Rahmen Innenseite 88 x 64 cm
- Datierung:
keine Angaben; vermutlich 1930er Jahre
- Sammlungsnummer:
DZO-0181
Überraschung überm Sofa
Stell Dir vor, Du räumst eine Wohnung aus und "triffst" auf Hitler! – So erging es einem Ehepaar im westfälischen Bevergern, heute ein Stadtteil von Hörstel, als es im Frühjahr 2021 nach dem Tod der Eltern bzw. Schwiegereltern deren Wohnung auflöste. Als die Eheleute das vertraute Landschaftsbild über dem Ledersofa abgenommen und die dünne Papierschicht auf der Rückseite beseitigt hatten, starrte ihnen der Diktator – gekleidet in Uniform und Mantel – unverhohlen entgegen.
Nach der ersten Überraschung kamen die Fragen: Wer hat das gemalt und warum? Ist das überhaupt Kunst? Wussten die Eltern von der "braunen Vergangenheit" des Bildes? Falls ja, warum wurde es in der Familie, die jeder NS-Nostalgie unverdächtig ist, so lange aufbewahrt? – Und vor allem: Was macht man mit so einem Fund?
Auf die letzte Frage fand sich am schnellsten eine Antwort: Im Frühjahr 2021 wurde das Gemälde von den Erben nach Nürnberg geschickt und als Schenkung der Sammlung des Dokumentationszentrums vermacht. In der Begleitmail stand: "Wir freuen uns, dass das Bild bei Ihnen gut aufgehoben ist. DAS EINZIG RICHTIGE!"
Ein Tafelbild – zwei Seiten
Obwohl keine Künstlersignatur zu entdecken war, erschloss sich dem Sammlungsteam des Museums auf den ersten Blick, dass die auf derselben Holzplatte aufgebrachten Gemälde von unterschiedlichen Händen stammten. Das besser gelungene Landschaftsbild auf der Vorderseite zeigt eine alpine Landschaft mit See und Birken. Schon in den 1960er Jahren schmückte es die damalige Wohnung der Familie, erinnerte sich der Schenker.
Auf der Rückseite war mutmaßlich seit mehr als 80 Jahren ein Kniestück Adolf Hitlers, einstiger NSDAP-Chef und Reichskanzler, verborgen gewesen. Tief ins Holz der Falzleiste eingedrehte Schrauben fixierten das Tafelbild am Rahmen, was zu Rissen im Holz beigetragen haben mag. Ihr neuzeitliches Aussehen lässt zusammen mit der langen Besitzdauer den Schluss zu, dass den Eltern die Vorgeschichte Ihres Wohnzimmergemäldes bekannt war. Vermutlich wollten sie sich vom Landschaftsbild nicht trennen und verhüllten deshalb seine zwar ohnehin verborgene "braune" Rückseite noch einmal zur Sicherheit.
Auch wenn das Gemälde aufgrund der Verschraubung nicht weiter untersucht werden konnte, erschien es vielversprechend, die gezeigte Darstellung Hitlers mit bekannten Aufnahmen des Diktators zu vergleichen. Bei diesen handelte es sich sämtlich um nationalsozialistische Propagandabilder – von ausgesuchten Fotografen sorgsam komponiert und teilweise von Adolf Hitler selbst zur Veröffentlichung freigegeben.
Hitler vom Hobbymaler
Die Darstellung des "versteckten Hitler" scheint von minderer Qualität zu sein. Etwa springen der viel zu kleine Kopf und der im Vergleich zum Körper zu groß geratene linke Arm sofort ins Auge. Offensichtlich hatte sich hier ein Hobbykünstler oder eine Hobbykünstlerin daran versucht, den "Führer" in Öl zu verewigen! Die plumpe Arbeit lässt Hitler statisch und distanziert, ja sogar etwas lächerlich erscheinen und hatte somit wenig mit ihrer Vorlage gemein. Das vorliegende Porträt wurde nämlich kurzerhand von einem weitverbreiteten Hitler-Portrait abgemalt, das als Teil einer Foto-Serie Anfang 1933 im Münchner Atelier des Fotografen Heinrich Hoffmann entstanden war. Der gebürtige Fürther war zu dieser Zeit schon länger ein Vertrauter Hitlers und bei offiziellen Anlässen dessen bevorzugter Mann hinter der Kamera.
Diese und ähnliche Aufnahmen waren mitnichten ästhetische Spielerein, sondern verfolgten handfeste medienpolitische Ziele. Als der "Führer" im März 1933 als Reichskanzler gewählt wurde, hatte er und seine Partei in den bürgerlichen Kreisen des Deutschen Reiches ein Imageproblem. Während der sogenannten Kampfzeit, also jener Periode, in der Hitler und die NSDAP offen gegen die Regierungen der Weimarer Republik hetzten, hatte sich das Bild eines lauten, vulgären und brutalen Krawallmachers in den Köpfen vieler Bürgerinnen und Bürger verfestigt. Nach der Übernahme der Regierungsverantwortung musste Hitler nun zeigen, dass er auch realpolitische Aufgaben und Probleme bewältigen und das Vertrauen breiter Bevölkerungskreise gewinnen konnte. Um seinen ehemals durchaus gewollten Ruf vergessen zu machen, ließ sich der Diktator nun bewusst als seriöser und kompetenter Staatsmann inszenieren. Hitler selbst saß ungern Modell, wusste jedoch: "Die breite Masse braucht ein Idol", wie Tobias Ronge in seiner Arbeit über Herrscherbilder im Nationalsozialismus schreibt. Vor diesem Hintergrund ist auch das vorliegende Hoffmann-Motiv zu sehen.
Von besagter Serie von 1933 wurden vier Fotografien von Hitler zur Veröffentlichung freigegeben, darunter zwei Standbilder, die ihn im Mantel bis zu den Knien zeigen. Eine Postkarte des Standbilds mit geradem Blick und der Aufschrift "Reichskanzler Adolf Hitler" befindet sich in der Sammlung des Dokumentationszentrums. Das zweite Standfoto mit der Blickrichtung leicht nach links wurde u.a. auf einer Montage für ein Wahlplakat 1934 verwendet. Dieses Motiv dürfte als eigentliche Vorlage für den "versteckten Hitler" gedient haben, denn auf beiden Bildern blickt der Diktator leicht nach links.
Das nationalsozialistische Herrscherbild – Vorbilder und Ikonografie
Um nach der Machtübernahme das "Image des meinungspolarisierenden Parteiführers in das beschwichtigende Bild einer nationalen Integrationsfigur" überführen zu können, nahm Hitler – so Rudolf Herz – Anleihen "bei der traditionellen Herrscherikonografie" und kombinierte sie mit "Bilderwartungen autoritär-militärischen Zuschnitts".
Das zeigt sich auch bei den Standfotos aus dem Atelier Hoffmann: Mit leichter Untersicht blickt der Betrachter hinauf zu Hitler, der sich in der sogenannten Rigaud-Pose präsentiert, benannt nach Hyacinthe Rigaud, dem bedeutendsten Adelsporträtisten des Barockzeitalters. Der Mantel sollte, so Herz, an den Krönungsmantel erinnern, "herrschaftliche Würde", "Autorität und staatsmännische Besonnenheit" ausstrahlen. Entschlossen wirkt die in die Hüfte gestützte rechte Hand. Die in den Oberschenkel gedrückte linker Faust, erinnere dagegen an zeitgenössische Fotos von Frontsoldaten, die als Handgranatenwerfer ihre Kampfbereitschaft signalisieren wollten. Die Krawatte mit Hoheitszeichen sowie Schulterriemen und Koppel komplettieren die Uniform. Die linke Brusttasche ziert das Eiserne Kreuz I. Klasse und das Verwundetenabzeichen, mit denen der Gefreite Hitler im Ersten Weltkrieg ausgezeichnet worden war. Tatsächlich wird Hitler hier schon denkmalhaft inszeniert, der "Führer" der vermeintlich klassenlosen "Volksgemeinschaft" sollte für deren Mitglieder aber auch nicht zu entrückt rüberkommen.
"Reichsbildberichterstatter" Heinrich Hoffmann und sein Beitrag zum Führer-Kult
Zur Stilisierung von Hitler als charismatische Führerfigur trug der Verlag von Heinrich Hoffmann wesentlich bei. Seine bevorzugte Stellung verdankte Photo-Hoffmann mit Sitz in München nicht nur der frühen Unterstützung für die NSDAP und der tiefen Freundschaft, die der Fotograf zu Hitler aufbauen konnte, sondern auch dem "Gesetz zum Schutz nationaler Symbole". Es war am 19. Mai 1933 erlassen worden und bestimmte unter anderem, dass Darstellungen von führenden Persönlichkeiten des Staates und der Partei nicht ohne Erlaubnis des Reichspropagandaministeriums veröffentlicht werden durften. Städte wie München und Augsburg richteten daraufhin sog. "Kitschkommissionen ein", die den Verkauf von Hitler-Fotoserien oder -Gemälden, die nicht den Auflagen nach repräsentativ-würdevoller Darstellung oder den künstlerischen Ansprüchen entsprachen, ablehnten. Der Sammlungseingang aus Bevergern hätte den Vorgaben dieses Gesetzes keinesfalls entsprochen und wäre demnach verboten oder sogar zerstört worden. Seine Überlieferung zeigt, dass die absolute Kontrolle über Herstellung und Verbreitung von "Führerbildern" nicht möglich war.
Die Folge des Gesetzes war eine übersichtliche Zahl "sicherer" Führerbilder, die von Kunst- und Buchhandel bevorzugt und massenhaft verbreitet wurden. Ein ergänzender Erlass des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, bestimmte 1937 als Ausnahme von der Vorlagepflicht einzig die Ansichtskarten aus dem Hause des "Reichsbildberichterstatters" Heinrich Hoffmann. Mit all dem wurde der Weg des Führerbildes zum Kultbild, das alle Schulen, Amtsstuben und bald auch viele Betriebsräume und private Haushalte schmückte, geebnet – und "Photo-Hoffmann" war von Anfang an einer seiner Garanten.
Eine Strategie, um die "Profitmaschine Führerbild" am Laufen zu halten, verfolgte der Monopolist mit der Reproduktion seiner Hitler-Fotos durch Kunstmaler, darunter auch die der Standbilder von 1933: Als Postkarte Nr. 426 gab der "Verlag Heinrich Hoffmann" ein Gemälde von Bruno Jacobs (*1884) heraus, auf dem Hitler allerdings die linke Hand in die Hüfte stützt, so dass der zurückgeschlagene Mantel den Blick auf die Orden und militärischen Verdienste des "Führers" freigibt. Eine weitere Darstellung ist vom Maler Hans-Werner Schmidt (1859-1950) für die NS-Ehrenhalle in Buchholz bei Hannover überliefert: Hier ragt hinter der bekannten Hitler-Darstellung das Brandenburger Tor auf.
Bevergern und die Nazis
Die genannten Maler gehörten nicht zur ersten Garde der Künstler im NS-Staat, deren Bildnisse von NS-Prominenz auf der jährlich stattfindenden "Großen Deutschen Kunstausstellung" in München an herausgehobener Stelle präsentiert wurden. Bildende Künstler aus der zweiten oder dritten Reihe, die vom gewollten exzessiven Bilderkult um den "Führer" profitieren, sich aber nicht der Gefahr eines Verkaufsverbots aussetzen wollten, wählten aus den genannten Gründen besser eine autorisierte Vorlage.
Der Maler oder die Malerin des "versteckten Hitler" aus Bevergern hatte zwar wie Jacobs und Schmidt auch auf das bekannte Hitler-Motiv zurückgegriffen, aber sicher keine künstlerische Ausbildung genossen. Die grimmig wirkende Darstellung Hitlers in der gedeckten Farbkombination schwarz-beige mag man sich eher in einem Parteilokal der NSDAP oder einem Treffpunkt der lokalen Hitlerjugend vorstellen, als in einem Wohnzimmer.
Auch wenn die Vorlage identifiziert werden konnte, bleiben bei diesem Sammlungsobjekt mehr Fragen als Antworten. Aufschlussreich ist allerdings der Auffindeort des Bildes: Bevergern war Geburts- und Wirkungsort von Viktor Lutze, der als Stabschef der SA von 1934 bis 1938 bei den Reichsparteitagen in Nürnberg an der Seite von Hitler auftrat. 1938 ließ Lutze in Bevergern das Gut Saltenhof für sich errichten, in dessen Nähe er nach einem tödlichen Verkehrsunfall 1943 auch begraben wurde. Heute noch zieht das Grab des prominenten NS-Funktionärs rechte Kreise an, wie die Schenker in ihrer Begleitmail schrieben.
Wohin mit den Hitler-Devotionalien nach 1945?
Mit der Niederlage und dem Einmarsch der Alliierten wurden im April und Mai 1945 schlagartig Tausende Herrscherbilder zu Täterbildern. Sie wurden versteckt, verbrannt oder hier und da auch rituell geschändet. "Bei uns hing Mama das Bild von Onkel Karl ab", so Zeitzeugin Ursula Leber in ihrem Buch "Im Schatten des Berges", "der uns bisher in der Hauptmann-Uniform siegreich angeschaut hat. An seine Stelle kam ein unverfängliches Blumenbild, das aber noch einen verschmutzten Rand hinterließ, da es kleiner war als der Hauptmann."
Nicht ausgetauscht, sondern auf der Rückseite mit einem neuen unbelasteten Landschaftsmotiv bemalt, und wieder aufgehängt – das war der Weg, den mutmaßlich die Erstbesitzer des Sammlungseingangs aus Bevergern beschritten. Dass sie nur aus Materialmangel das Hitlerbild umnutzten, mag man allerdings nicht glauben, auch eine Übermalung wäre schließlich eine gangbare Option gewesen. Es wirkt ganz so, dass das Hitler-Bild, das man vielleicht selbst gemalt hatte, genauso erhalten werden sollte, wie die Erinnerung an 12 Jahre Diktatur.
Er ist wieder da! – nicht nur in Westfalen
"Wie bei keinem anderen deutschen Politiker vor Hitler wurde das Portrait zum Träger seines Images in der Öffentlichkeit", schreibt Ronge in seinem Kapitel über das Herrscherbild als Kultobjekt. Das spiegelt auch die Sammlung des Dokumentationszentrums mit einer Vielzahl von Hitler-Darstellungen. Von den Objekten, die den "Führer" erst auf den zweiten Blick offenbaren sei hier nur ein Bierkrug genannt, der vielleicht aus der Zeit des Parteiverbots nach dem Hitlerputsch 1923 stammt: Erst wenn sein Inhalt zur Neige ging, tauchte mit jedem Schluck ein bisschen mehr Hitlers Konterfei auf, das im Boden eingearbeitet war.
"Versteckte" Hitlerbilder auf Gemälden machten in den letzten Jahren dagegen mehrfach in der Presse von sich reden: Im Rollettmuseum Baden-Baden hatte sich nach einer Röntgenuntersuchung das Konterfei des Tiroler Nationalhelden Andres Hofer als "U-Boot" für ein Hitler-Portrait entpuppt, das nach 1945 vom Besitzer übermalt worden war. Die Durchleuchtung von Erwin Hahs' "Großes Requiem" im Zuge der Ausstellung "Die schwarzen Jahre. Geschichten einer Sammlung. 1933-1945" offenbarte 2016 auch ein Hitler-Portrait.
Nicht übermalt, sondern nur "umgedreht" worden war "Brauner Dreck im Weißen Rößl", wie es auf der Tiroler Website "dietiwag tagebuch" heißt. In der Innsbrucker Gaststätte soll bis Mai 2018 der Wirt bei "bestimmten geselligen" Runden durchaus die "Führer"-Ansicht präsentiert haben und nicht den Heimatschinken der offiziellen Vorderseite. Diese Geschichte erinnert an das Wendebild aus Kitzingen in der Museumssammlung, das bereits 2021 "Ans Licht geholt" wurde.
Der Hitlergruß – eine "unheilvolle Geste" als massenhafte Praxis beim Reichsparteitag
Das "versteckte Hitler-Bild" – ein Glücksfall für das Museum
Dem Dokumentationszentrum werden häufig Fotos von Fundstücken aus der NS-Zeit übermittelt, deren Absendern es vorrangig um eine pekuniäre Bewertung für das anschließende Feilbieten im Internet geht. Auch der "versteckte Hitler" war von seinen neuen Besitzern einem Auktionshaus angeboten worden, allerdings nur aus Interesse an der Reaktion: Vom Startpreis 250 EUR wollte man dort "mal sehen, wo die Reise dann hingeht." Die Antwort bestärkte die Besitzer darin, das Bild an ein geeignetes Museum abzugeben.
Das Dokumentationszentrum bewertet diese und andere Schenkungen nicht nach ihrem Wert auf einem überhitzten und teils fragwürdigen Markt, sondern nach dem historisch-politischen Erkenntniswert und nach den gesellschaftlichen oder persönlichen Geschichten, die sich daraus erschließen und erzählen lassen. Eine der neuen Fragen, mit der sich die künftige Dauerausstellung beschäftigen wird, lautet: "Was bleibt aus 12 Jahren Diktatur?". Dabei werden das laienhaft gemalte Hitler-Bild aus dem Wohnzimmer in Bevergern und viele andere Objekte aus der Sammlung des Dokumentationszentrums eine wichtige Rolle spielen.
Zum Weiterlesen, Weiterforschen:
Rudolf Herz: Hoffmann & Hitler. Fotografie als Medium des Führer-Mythos, München 1994
Rolf Rietzler: Mensch, Adolf: Das Hitler-Bild der Deutschen seit 1945. Ansichten eines Zeitgenossen, München 2016
Tobias Ronge: Das Bild des Herrschers in Malerei und Grafik des Nationalsozialismus. Eine Untersuchung zur Ikonografie von Führer- und Funktionärsbildern im Dritten Reich, Berlin 2010 (Kunstgeschichte, Bd. 89)
Reihe "Ans Licht geholt – aus der Sammlung des Dokumentationszentrums"
Text und Recherche: Daniela Harbeck-Barthel; mit Beiträgen von Andreas Stelzl
05.09.2022
Textlizenz: CC BY SA 4.0
© Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände
Die Bilder dürfen nur nach Rücksprache mit dem Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände genutzt werden!
Kontaktformular
Danke an Martin Ammon von den Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg für die Unterstützung.